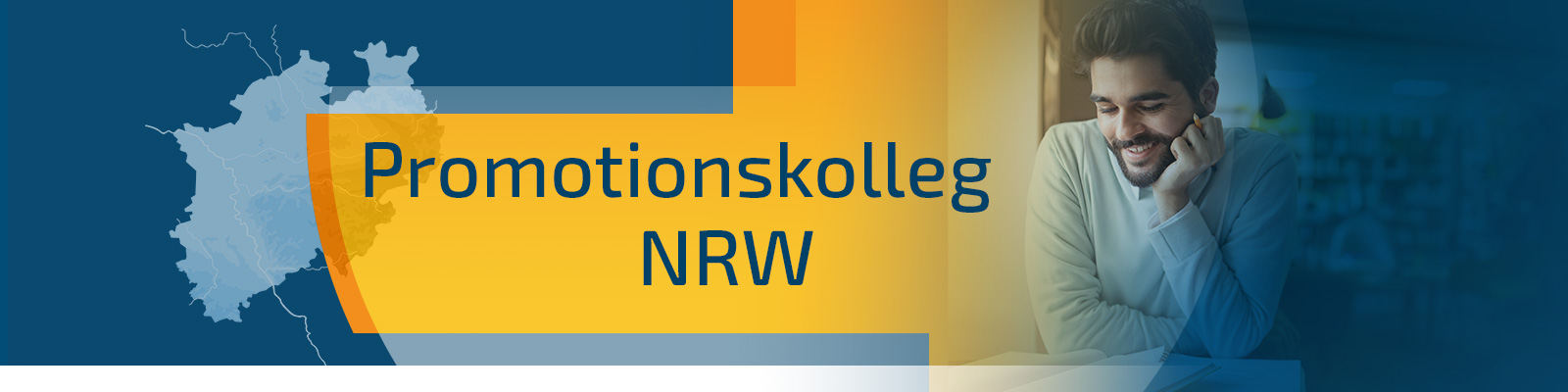Die Abteilung Unternehmen und Märkte lädt herzlich zur digitalen Ringvorlesung der UuM im Wintersemester 2025/26 ein! Anmeldungen sind per Mail an die Koordination möglich.
Es stehen wieder viele spannende Themen parat, die von unseren Mitgliedern angeboten werden:
03. Dezember 2025 (Mi), 14:00-15:30 Uhr
Prof. Dr. Katja Bender & Dr. Sebastian Heinen, HS Bonn-Rhein Sieg
Was erklärt die unterschiedlichen Präferenzen von Forschenden hinsichtlich der Zusammenarbeit mit der Praxis? – Erkenntnisse aus deutschen außeruniversitären Forschungseinrichtungen und Hochschulen für angewandte Wissenschaften
Viele deutsche außeruniversitäre Forschungseinrichtungen (AUF) – insbesondere Institute der Max-Planck-Gesellschaft, der Fraunhofer-Gesellschaft, der Leibniz-Gemeinschaft und der Helmholtz-Gemeinschaft – blicken auf eine lange Tradition der transdisziplinären Wissensgenerierung zurück. Auch Hochschulen für angewandte Wissenschaften (HAW) sind für ihre tiefgehende und vielfältige Kooperation mit der Praxis bekannt. Allerdings unterscheiden sich die Forschungsdisziplinen, Methoden, Organisationsansätze und individuellen Denkweisen zwischen und innerhalb der fünf Gruppen erheblich, was es schwierig macht, Forschungsteams dazu zu motivieren, aktuelle Herausforderungen durch die gemeinsame Erarbeitung umsetzbarer Erkenntnisse mit Partnern aus der öffentlichen und privaten Praxis anzugehen. Als Basis einer maßgeschneiderten Wissenschaftspolitik messen wir die Präferenzen von 925 Forschenden in AUF und HAW hinsichtlich Praxiszusammenarbeit anhand eines online durchgeführten Discrete Choice-Experiments. Darin entschieden sich die Teilnehmenden für eins von zwei hypothetischen Forschungsprojekten, welche durch sechs Attribute (Fördervolumen, akademischer Erfolg, gesellschaftlicher Impact, Wissenstransfer, Wissens-Koproduktion und Art des Praxispartners) gekennzeichnet waren, von denen die meisten aus drei Stufen (niedrig, mittel, hoch) bestanden. Die Befragten wurden zufällig in zwei Blöcke eingeteilt, die beide acht Entscheidungen treffen mussten. Standardlogistische Regressionen ergeben für fast alle Attributstufen hochsignifikante Koeffizienten. Der Vergleich organisationsspezifischer Teilstichproben zeigt deutliche Präferenzunterschiede zwischen Forschenden verschiedener Arbeitgeber, insbesondere zwischen Max Planck- und Fraunhofer-Angestellten. Im Gegensatz dazu erklären verschiedene soziodemografische Merkmale wie Geschlecht, Forschungserfahrung, Befristung etc. nur einen sehr geringen Teil der beobachteten Präferenzheterogenität. Auf der Grundlage unserer Ergebnisse diskutieren wir Ansätze, wie Transdisziplinarität unter den Tausenden von Spitzenforschenden in der deutschen öffentlichen Forschung gefördert werden kann.